
Kaiser Karl IV. - Neustadt a.d. Waldnaab - "Goldene Straße"
Neustadt an der Waldnaab und Kaiser Karl IV.
Die Förderung der Stadt an der „Goldenen Straße“
Autor: Michael Knauer
Allgemeines zur Geschichte der „Goldenen Straße“
Es gab in der Oberpfalz im Mittelalter eine Vielzahl an „kleineren“ Straßen, die lediglich von lokaler Bedeutung waren. Hinzu kamen jedoch auch überregionale Straßen, die teils zu enormer Wichtigkeit für den Handel avancierten. Eine dieser Straßen, die auch die bekannteste und bedeutendste unseres Raumes darstellt, ist die „Goldene Straße“. Woher sie ihren Namen erhielt, kann heute nicht mehr genau nachvollzogen werden. Es ist allerdings ein historischer Name, der erstmals in einem Bericht des Bärnauer Pflegers Hans von Uttelhofen nachzulesen ist, der auf das Jahr 1513 datiert ist. Es gibt verschiedene Vermutungen, welche besagen, dass sich der Name von der „Goldenen Stadt“ Prag ableiten oder sich auf den Handel zurückführen lässt, durch den die an ihr gelegenen Ortschaften und Städte enorm profitierten. Vielleicht geht der Name auch auf die vielen böhmischen Könige zurück, die nach einer Anordnung Kaiser Karls IV. zur Wahl und Krönung des deutschen Kaisers sowie zu Reichstagen auf dieser Straße ins Reich zu kommen hatten. Die Straße existierte jedoch schon lange Zeit vor diesem Kaiser. So wurde sie bereits in der Zeit des böhmischen Herzogs Bretislaw I. um 1034 nachgewiesen. Unter der Regierung Kaiser Karl IV. aber erreichte sie erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Diese Verbindung zwischen Böhmen und Bayern änderte zwar im Laufe der Jahrhunderte ihren Verlauf, blieb jedoch vom Spätmittelalter bis hin zum Ende des 18. Jahrhunderts die wichtigste Handels- und Verkehrsroute der beiden Königreiche.
Kaiser Karl IV. und Neuböhmen
Der gebürtige Luxemburger Kaiser Karl IV. lebte von 1316 bis 1378. Die
Geschichtsschreiber
 bezeichnen
ihn als einen
intelligenten
Herrscher mit scharfem Verstand und ausgeprägtem politischen Instinkt.
Nicht zuletzt die Kenntnis von fünf Sprachen machten ihm das Herrschen
leichter.
Er verfügte aufgrund seiner Herkunft über eine große Hausmacht, war
mächtiger als viele seiner Vorgänger und baute diese
Vorrangstellung geschickt aus.
bezeichnen
ihn als einen
intelligenten
Herrscher mit scharfem Verstand und ausgeprägtem politischen Instinkt.
Nicht zuletzt die Kenntnis von fünf Sprachen machten ihm das Herrschen
leichter.
Er verfügte aufgrund seiner Herkunft über eine große Hausmacht, war
mächtiger als viele seiner Vorgänger und baute diese
Vorrangstellung geschickt aus.
Als König von Böhmen gehörte er zu den Deutschen Reichsfürsten, wobei sein
Reichtum ihm eine besondere Stellung einbrachte.
Die
Vermählung mit
Frauen aus anderen bedeutenden Geschlechtern
(Kaiser Karl IV. war vier mal verheiratet)
vermehrten
seinen
Besitz.
Durch Tausch, Kauf, Verpfändung und Erbschaft wurde das
Territorium immer weiter ausgebaut. Mit
dem
Grunderwerb von den Wittelsbachern konnte er so umfangreiche Gebiete in
der
„Oberen Pfalz“ erwerben, die er im Jahr 1355 als eigenständiges
Territorium der böhmischen Krone angliederte. Dieses Gebiet wurde später
als
„Neuböhmen“ bezeichnet.
Als Hauptstadt wählte er dabei Sulzbach, das bis zum Jahr 1373
die
Hauptstadt Neuböhmens
war. Dadurch erhielt Sulzbach eine herausragende Stellung neben
Nürnberg und Prag an der „Goldenen Straße“. Mit dem Erwerb dieser Gebiete
war Kaiser Karl IV. im Besitz eines zusammenhängenden Reichsgebietes, das
von Luxemburg über Nürnberg bis nach Prag reichte.
Der Verlauf der „Goldenen Straße“
Rund 300 km
liegen zwischen den beiden Städten Nürnberg und Prag, die durch die
„Goldene Straße“ verbunden werden. Dabei muss man allerdings zwischen zwei
unterschiedlichen Verläufen differenzieren. Der Großteil der Strecke,
welche die beiden großen Städte Prag und Nürnberg verband, blieb dabei
über all die Zeit zwar die gleiche, doch gab es im Gebiet an der
böhmischen Grenze zwei verschiedene Trassen.
Die ältere der beiden verlief von Nürnberg, Sulzbach über Hirschau,
Wernberg, Waidhaus und Pfraumberg nach Pilsen und weiter nach Prag. Dieser
Abschnitt wurde jedoch unter Kaiser Karl IV. verboten, wodurch diese
Strecke auch den Namen „Verbotene Straße“ erhielt. Er ordnete an, dass die
„Goldene Straße“ von
Nürnberg über Erlenstegen, Lauf,
Sulzbach, Hirschau,
Kohlberg, Etzenricht, Weiden,
Altenstadt/WN, Neustadt/WN,
Püchersreuth, Plößberg, Bärnau
und Tachau nach Pilsen
und Prag zu verlaufen hatte.
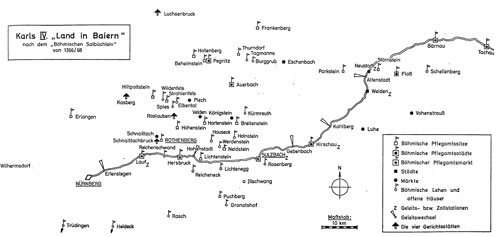
Dies stellte
zwar einen Umweg gegenüber dem alten Verlauf dar, hatte jedoch einen ganz
einfachen Hintergrund: der Kaiser verlegte nämlich den Verlauf der Straße
durch sein eigenes Herrschaftsgebiet, welches er zuvor erworben hatte,
wohingegen sie zuvor durch Besitzungen des Landgrafen von Leuchtenberg
ging. Dadurch erhöhten sich die Steuereinnahmen Karls IV. durch die
Abgaben, welche die Händler den einzelnen Ortschaften entrichten mussten.
Zur Hauptstadt seiner neu erworbenen Gebiete, die erst in unserer Zeit die
Bezeichnung „Neuböhmen“ erhielten, machte er Sulzbach, das als
Regierungssitz ein wichtiger Durchgangsort entlang des Verkehrsweges war.
Somit lässt sich der Verlauf der „Goldenen Straße“ folgendermaßen
skizzieren: Sie hatte ihren Ursprung im Westen in Nürnberg und erstreckte
sich von Lauf, Hersbruck über Sulzbach bis nach Hirschau. Dort teilte sie
sich, wie oben beschrieben, in die „Goldene Straße“ und in die „Verbotene
Straße“ auf.
Der Weg verlief somit während der Blütezeit der Straße über Weiden,
Neustadt/WN, Plößberg, Bärnau und Tachau, bzw.
die verbotene Straße über Wernberg, Waidhaus und Pfraumberg, wo
sich die beiden Routen wieder trafen, um durch Pilsen hindurch nach Prag
zu
führen.
Nach dem Tod Kaiser Karls IV. gingen die Kaufleute wieder langsam
dazu über, den Weg über die „Verbotene Straße“ zu wählen, da die Höhe bei
Bärnau mit 712 m ein zu umständliches Hindernis darstellte, welches man
umgehen wollte.
Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts war dann die Strecke über Wernberg,
Leuchtenberg und Vohenstrauß wieder die einzig befahrene Route. Dies hatte
wiederum großen Einfluss auf die Einnahmen der Städte, die jetzt umgangen
wurden. So lässt sich aus einer Urkunde des Weidener Stadtarchivs die
Klage der böhmischen Stadt Tachau entnehmen, die an die Stadt Weiden
gerichtet war, dass der ehemals vorgegebene Weg umgangen wird und die
beiden Städte dadurch einen erheblichen Schaden durch Verluste von
Steuereinnahmen zu erleiden hätten.
Sichtbare Überreste der „Goldenen Straße“
Die heute
noch sichtbaren Spuren alter Verkehrswege befinden sich größtenteils an
Berghängen. An diesen Stellen wühlten die Räder der Fuhrwerke den Boden
stark auf. Der Regen trug das gelockerte Erdreich später ab, wodurch sich die Wege in das Gelände eingruben. Somit entstanden Hohlwege, an
denen man noch heute den Verlauf von Altsraßen festmachen kann.
sich die Wege in das Gelände eingruben. Somit entstanden Hohlwege, an
denen man noch heute den Verlauf von Altsraßen festmachen kann.
Als Beispiel in unserer Region ist hierfür ein Hohlweg
 zwischen
Wildenau und Plößberg anzuführen, der sich auf dem Teilstück des von
Kaiser Karl IV. vorgegebenen Verlaufs der „Goldenen Straße“ befindet.
Direkt neben einer geteerten Flurbereinigungsstraße befindet sich am
Waldrand ein durch den Oberpfälzer Waldverein ausgeschilderter Hohlweg,
der genau diese Spuren aufweist.
zwischen
Wildenau und Plößberg anzuführen, der sich auf dem Teilstück des von
Kaiser Karl IV. vorgegebenen Verlaufs der „Goldenen Straße“ befindet.
Direkt neben einer geteerten Flurbereinigungsstraße befindet sich am
Waldrand ein durch den Oberpfälzer Waldverein ausgeschilderter Hohlweg,
der genau diese Spuren aufweist.
Neben Hohlwegen dienen auch noch vorhandene Überreste von
Befestigungsanlagen, wie zum Beispiel Burgställe, zur Bestimmung des
Verlaufs von Altstraßen. Unmittelbar am nördlichen Stadtrand von Neustadt,
nahe dem heutigen Rastenhof, ist ein solcher noch immer deutlich zu
erkennen. Dieser diente für die dort ansässige Bevölkerung als Schutz- und
Fliehburg vor auf der vorbeilaufenden „Goldenen Straße“ umherziehenden
Räuberbanden und Gesindel.
Der Schutz der „Goldenen Straße“
Die
„Goldene
Straße"
war wie schon mehrfach ausgeführt
die
wichtigste Handelsverbindung zwischen Nürnberg und Prag. Aus diesem Grund
lag dem Kaiser auch sehr viel an ihrem
Schutz,
weshalb
er
sie
durch die Errichtung von
zahlreichen Amtssitzen und Burgen
sicherte.
Diese sind auch unter dem Begriff „Pflegeämter“ bekannt. Als solche
benannte er an der „Goldenen Straße“ Lauf, Hersbruck, Sulzbach, Hirschau,
Parkstein, Störnstein und Bärnau.
Der
Sitz des Hauptmanns, der erster Beamter unter dem Kaiser in Neuböhmen war,
fiel wiederum auf die Hauptstadt Sulzbach. So standen unter dessen Befehl
„vier Türmer (Wachposten auf den Türmen), ein Torwart, acht Wächter, zwölf
Bewaffnete zu Fuß und acht Bewaffnete zu Pferde.“ Dies war eine
beträchtliche Anzahl zum Beispiel im Vergleich zu Lauf, wo dem dort
ansässigen Pfleger lediglich 18 Menschen und 13 Pferde unterstanden.
Im Falle eines Konflikts ließen sich diese Söldner durch bewaffnete Bürger
erheblich verstärken.
Im böhmischen
Salbüchlein
wurde durch
Kaiser Karl IV.
genau festgelegt, welche Waffen oder Ausrüstungsgegenstände vorhanden sein
mussten:
Sulzbach 144 Harnische,
ebenso viele Bewaffnete und
146 Helme.
Somit ließ sich die wehrhafte Besatzung auf mindestens 144 bzw. 146 Bürger
ausweiten.
Weiter waren
auf der Burg Parkstein 16 Harnische,
30 Armbrüste
und zwei Spannbänke (Bänke zum Spannen der Armbrüste)
zu lagern und
„die von
der Weiden“
hatten 100 Harnische
(Rüstungen)
und 100 Lanzen
bereit zu halten.
Trotz dieser
Vorkehrungen gab es dennoch Überfälle und räuberische Erpressungen. So wird
berichtet, dass im Jahr 1395 eine Gesandtschaft aus Straßburg bei Tachau
gefangen genommen und eine andere bei Bärnau
beraubt wurde.
Der Weg Kaiser Karls IV. über die „Verbotene Straße“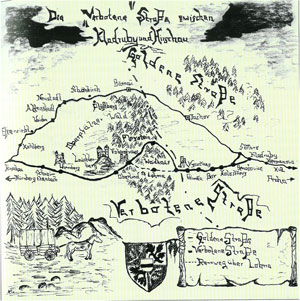
Kaiser Karl
IV., der ja wie oben beschrieben die Benutzung der „Verbotenen Straße“
unter Strafe stellte, verstieß jedoch im März 1350 selbst gegen seine
erlassene Vorschrift, als es um den Transport seiner Kronjuwelen von Prag
nach Nürnberg ging. Dabei traute er scheinbar seinen eigenen
Sicherheitsvorkehrungen nicht, da er die verbotene Route wählte. Aus dem
Protokoll der Reisedaten lässt sich ein Schluss über die Reisedauer von
Prag nach Nürnberg ziehen.
Die Abfahrt mit einem Pferdewagen fand am 29. März 1350 in Prag statt. Der
Zug reiste über Waidhaus und erreichte am 1. April Wernberg. Nach zwei
weiteren Tagen erfolgte am 3. April die Ankunft in Nürnberg. Die Reise
erstreckte sich somit über sechs Tage. Diese Reisedauer dürfte auch in
etwa für die „Goldene Straße“ zutreffen. Betrachtet man jedoch die
Reisedauer schwer beladener Kaufmannswägen, so waren diese wesentlich
länger unterwegs. Dabei kann man von einer Dauer von bis zu 14 Tagen
ausgehen.
Was wurde alles auf der „Goldenen Straße“ befördert?
Die „Goldene Straße“ war nicht nur ein Verbindungsweg mit einer großen
politischen Bedeutung. Auch die wirtschaftliche Wichtigkeit lässt sich
anhand der auf ihr transportierten Güter und Waren erkennen. So kamen aus
Böhmen z.B.
Häute, Wachs, Spezereien, Kupfer, Zinn, Eisen, Heringe, Unschlitt,
Schinken,
Salz,
Loden und Ochsen. Nach Osten wurden transportiert: u.a.
flandrische Tuche, Sämereien, Getreide, Wein, Wolle und Eisenwaren.
Wie wichtig diese Verbindung auch in überregionaler Sicht war, zeigt sich
am Beispiel der Deutschen Hanse. Dieser bedeutendste Wirtschaftsbund des
Mittelalters und der frühen Neuzeit benutzte ebenfalls
die „Goldene Straße“ als Handelsweg.
Jan Hus auf der „Goldenen Straße“
 Neben
Mitgliedern aus
Politik und Wirtschaft zog
auch ein großer Reformator auf
dieser
Ost-West-Verbindung.
Jan Hus begab sich im Jahr 1414 auf der „Goldenen Straße“ von Böhmen aus
zum Konzil nach Konstanz, wo er,
trotz vorherig anders lautendem
Versprechen,
qualvoll auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.
Neben
Mitgliedern aus
Politik und Wirtschaft zog
auch ein großer Reformator auf
dieser
Ost-West-Verbindung.
Jan Hus begab sich im Jahr 1414 auf der „Goldenen Straße“ von Böhmen aus
zum Konzil nach Konstanz, wo er,
trotz vorherig anders lautendem
Versprechen,
qualvoll auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.
Aus dieser Hinrichtung resultierten
dann kurze Zeit später die Hussitenkriege,
die besonders die Oberpfalz trafen. Die Anhänger des Jan Hus benutzten die
Straße, um nach Westen zu ziehen. Die deutschen Heere, die dies verhindern
wollten, trafen sich drei mal in Weiden und marschierten zwischen 1422 und
1430 auf der „Goldenen Straße“ nach Osten.
Die Förderung der Ortschaften entlang der „Goldenen Straße“ durch Kaiser Karl IV. am Beispiel der Stadt Neustadt a.d. Waldnaab
Die
Ortschaften entlang der Goldenen Straße hatten nicht nur große Vorteile
durch Zoll- und Steuereinnahmen von Händlern und Reisenden, sondern wurden
auch gezielt gefördert. Kaiser Karl IV. stattete sehr viele Orte seines
Herrschaftsgebietes in Neuböhmen mit Privilegien und Vergünstigungen aus.
Zu einer dieser Maßnahmen zählte auch die Übereignung von kaiserlichem
Waldbesitz an die Bürger einer Stadt.
So geschah es auch in Neustadt a.d. Waldnaab. Mit einer Urkunde vom 1.
August 1354 (Originalurkunde im Archiv der Stadt Neustadt a.d. Waldnaab)
verlieh der Kaiser den Neustädter Bürgern zehn Huben Holz bei Floß und
Parkstein.
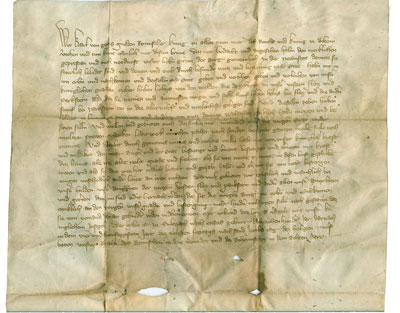 Im
Originalurkundentext heißt es hierzu:
Im
Originalurkundentext heißt es hierzu:
„Wir Carl Von Gotteß gnaden Römischer König zu allen Zeiten mehrer des
Reichs und König zu Boheimb [...]“ verleihen „unser liebe getreuen Burger
gemeinlich zu der neunstadt damit sie swerlich beladet sind und davon und
auch durch besunderen nutz und besserung unser stat habn wir inen, irn
erben und nachkommen und derselben unser stat gebe und verlihen geben und
verleihen von unserm kuniglichen gnaden zehen huben holtzes von den
weldern, die do gehoeren zu unser vesten floss und parkstein... “.
Nachdem die
Urkunde aus dem Jahr 1354 keine Unterschrift des Kaisers trägt, hinterließ
dieser der Stadt Neustadt seinen linken Handschuh als Zeichen der
Rechtsgültigkeit dieser Schenkung, was ein übliches Symbol im Mittelalter
war. Den Originalhandschuh kann man auch heute noch im Museum der Stadt
Neustadt a.d Waldnaab betrachten.
Eine Hube Holz entsprach zur damaligen Zeit einer Fläche, für deren
Bewirtschaftung drei bis vier Pferde notwendig waren. Nach heutigem Maß
ist es fünfzig Tagwerk gleich zu setzen.
Dieses Holz stand den Bürgern der Stadt Neustadt a.d Waldnaab und auch
später den Bürgern der Freyung als Brenn- und Bauholz zur freien
Verfügung. Als Kaiser Karl IV. im Jahre 1372 einen Teil seiner Herrschaft
in Bayern an Otto, Herzog in Bayern, verkaufte, wurde in diesem Vertrag
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Neustadt seinen Corporationswald
behalten sollte.
Dieses alte Holzrecht besteht auch heute noch. Jeder, der damals ein Haus
besaß, wurde als so genannter „Rechtler“ bezeichnet. 149 „Rechtler“
verwalten und bewirtschaften noch immer die Schenkung von Kaiser Karl IV.
Lediglich der Waldbesitz bei Floß wurde mit einem Tauschvertrag vom 20.
September 1828 mit einem Staatswald in der Nähe von Neustadt (Satzberg)
wegen der besseren Erreichbarkeit eingetauscht.
Die aus dem Verkauf des Holzes erzielten Gewinne werden noch immer
jährlich unter den „Rechtlern“ ausgezahlt. Im Jahr 2004 kann die
Neustädter Corporation ihr 650jähriges Jubiläum feiern. Dies ist eine
überaus bemerkenswerte Angelegenheit, da man solch alte Verträge, die
immer noch Bestand haben, nur mehr sehr selten findet.
Die Gründung des Ortsteils Freyung
Durch einen
weiteren Aspekt unter der Förderung Kaiser Karls IV. kam es in manchen
Städten auch zur Gründung neuer Ortsteile. Darauf soll anhand des
Beispieles des Ortsteiles „Freyung“ in Neustadt a.d. Waldnaab näher
eingegangen werden.
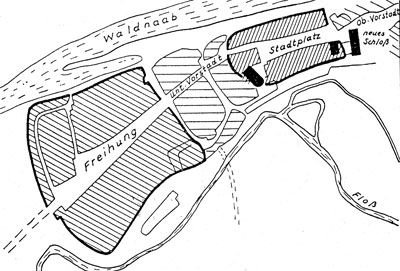 Beim Erwerb der
Stadt Neustadt a.d. Waldnaab durch Kaiser Karl IV. im Jahr 1353
beschränkte sich die Ausdehnung der Stadt lediglich auf den heutigen
Stadtplatz. Dieser war durch die Stadtmauern und aufgrund der
topografischen Lage (Bergrücken zwischen Waldnaab und Floß) derart
eingegrenzt, dass eine Ausbreitung der Stadt nur schwer möglich war. Durch
die Unternehmungen, seine Städte und Ortschaften von Böhmen bis Nürnberg
auszubauen, ergab sich für Neustadt a.d. Waldnaab die Gelegenheit, die
Stadt mit Unterstützung des Kaisers zu vergrößern.
Beim Erwerb der
Stadt Neustadt a.d. Waldnaab durch Kaiser Karl IV. im Jahr 1353
beschränkte sich die Ausdehnung der Stadt lediglich auf den heutigen
Stadtplatz. Dieser war durch die Stadtmauern und aufgrund der
topografischen Lage (Bergrücken zwischen Waldnaab und Floß) derart
eingegrenzt, dass eine Ausbreitung der Stadt nur schwer möglich war. Durch
die Unternehmungen, seine Städte und Ortschaften von Böhmen bis Nürnberg
auszubauen, ergab sich für Neustadt a.d. Waldnaab die Gelegenheit, die
Stadt mit Unterstützung des Kaisers zu vergrößern.
Diese Erweiterung sollte vor allem den Kaufleuten, die auf der Straße zur
der „Neuwen Stat“ wanderten, zu gute kommen. Die Grundlage dazu bildete
die Urkunde vom 23. Juli 1358. Darin gibt der Kaiser seinem Wunsch
Ausdruck, dass der neu geplante und ausgemessene Ortsteil möglichst
schnell besiedelt werden soll.
Er gewährte deshalb den neuen Siedlern noch zusätzliche Rechte, welche
ebenfalls in dieser Urkunde festgehalten sind: „...so haben wir von
besonderen unseren Gnaden allen denen, die in der selben größeren Stadt,
die wir, als vorbeschrieben steht, neulich begriffen haben, Bürgerrecht
empfangen haben oder noch empfangen werden und in der selben Stadt bauen,
wohnen und sitzen oder in künftigen Zeiten sitzen und wohnen werden, zwölf
ganze Jahre, angefangen von St. Georgen-Tag, der da erst vergangen ist,
rechte Freiheit von allen Zinsen, Steuern, Geschossen und anderen Gelten,
welcherlei sie sein möchten, gnädiglich gegeben haben und geben ihnen auch
die selbe Freiheit, um das, das sie dort selbst bauen und auch die Stadt
befestigen mögen.“
Der so entstandene neue Ortsteil besaß gegenüber der bereits vorhandenen
Stadt Neustadt a.d. Waldnaab einen eigenen Stadtplatz mit gleichartigen,
regelmäßig angelegten Häusern, sowie einen Handelsplatz. Da diese
Neubesiedlung vor allem zum Nutzen der Kaufleute gedacht war, gab es dort
keine landwirtschaftlichen Ansiedelungen.
Die Freyung war seit ihrer Gründung im Jahr 1358 bis ins Jahr 1559 als sie
mit der Stadt Neustadt a.d. Waldnaab zusammengeschlossen wurde, immer ein
eigenständiger Ortsteil mit eigenen Rechten und Pflichten gewesen.